Tag: AI

Modern application of Voice AI technology
With the advancement of technology and the gradually increasing use of artificial intelligence, new markets are developed. One of such is the market of Voice AI which became a commercial success with voice bots such as Alexa or Siri. They were mainly used as digital assistants who could answer questions, set reminders and they could…
AI and Scaling the Compute for the new Moore’s Law
AI and Scaling the Compute becomes more relevant as the strive for larger language models and general purpose AI continues. The future of the trend is unknown as the rate of doubling the compute outpaces Moore’s Law rate of every two year to a 3.4 month doubling. Introduction AI models have been rapidly growing in…
Die wachsende Macht von Sprachmodellen am Beispiel ChatGPT und Bewertung deren Skalierbarkeit
Die wachsende Macht von Sprachmodellen am Beispiel ChatGPT und Bewertung deren Skalierbarkeit
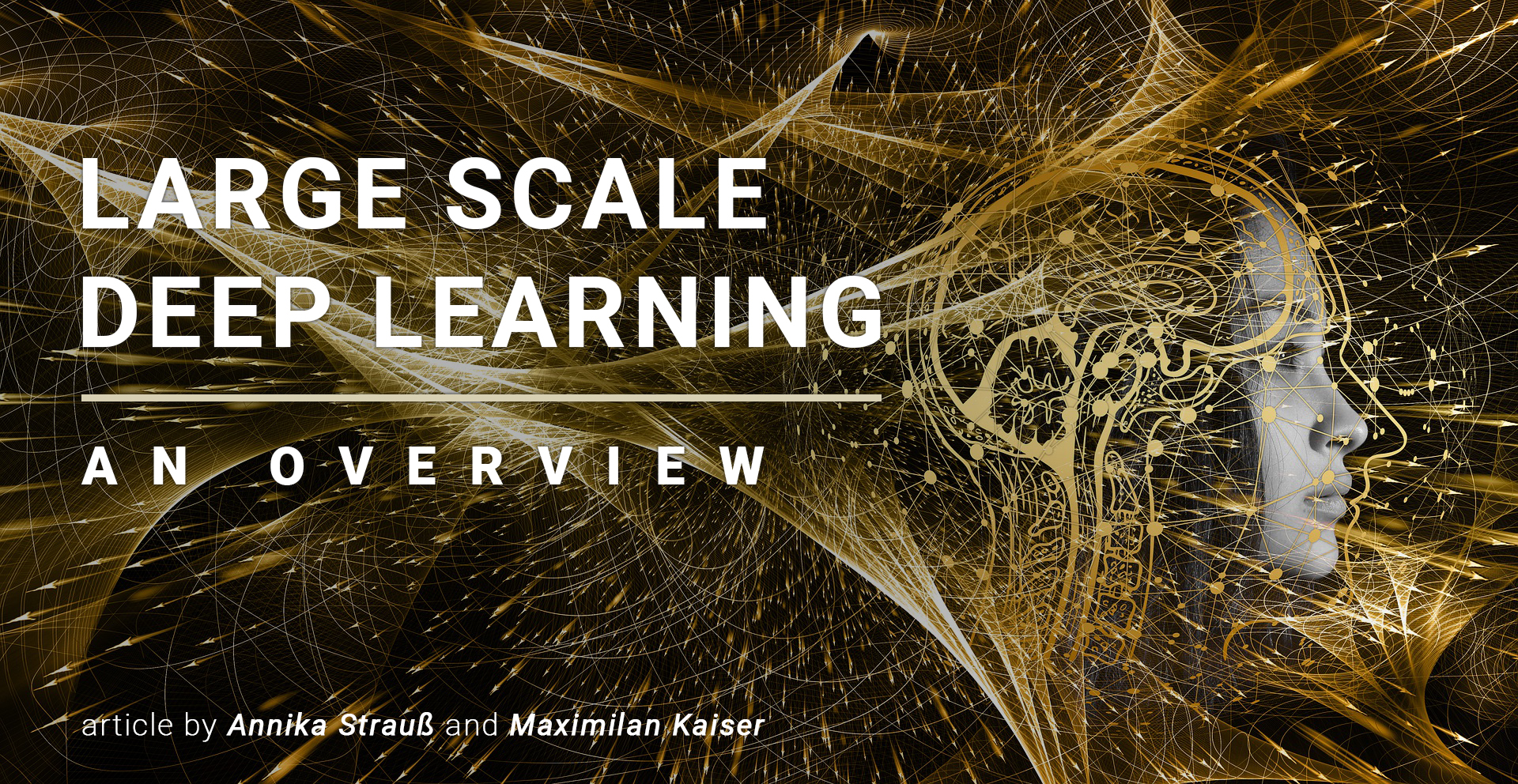 Allgemein, Artificial Intelligence, Deep Learning, System Architecture, System Designs, System Engineering, Ultra Large Scale Systems
Allgemein, Artificial Intelligence, Deep Learning, System Architecture, System Designs, System Engineering, Ultra Large Scale SystemsAn overview of Large Scale Deep Learning
article by Annika Strauß (as426) and Maximilian Kaiser (mk374) Introduction Improving Deep Learning with ULS for superior model training Single Instance Single Device (SISD) Multi Instance Single Device (MISD) Multi Instance Multi Device (MIMD) Single Instance Multi Device (SIMD) Model parallelism Data parallelism Improving ULS and its components with the aid of Deep Learning Understanding…
Verkehrserkennung mit Neuronalen Netzen
Einleitung Hast du beim Lernen auch schon einmal gelangweilt aus dem Fenster geschaut und die vorbeifahrenden Autos gezählt? Auf wie viele Autos bist du dabei genau gekommen und war diese Zahl vielleicht auch vom Wochentag oder der Uhrzeit abhängig? In unserem Projekt haben wir versucht diese Frage zu beantworten.Dafür haben wir mittels Maschinellem Lernen, auch…
The Dark Side of AI – Part 2: Adversarial Attacks
Find out how AI may become an attack vector! Could an attacker use your models against your? Also, what’s the worst that could happen? Welcome to the domain of adversarial AI!
The Dark Side of AI – Part 1: Cyberattacks and Deepfakes
Introduction Who hasn’t seen a cinema production in which an AI-based robot threatens individual people or the entire human race? It is in the stars when or if such a technology can really be developed. With this series of blog entries we want to point out that AI does not need robots to cause damage.…
